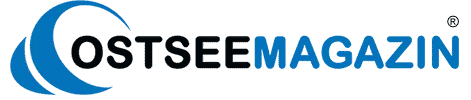Salz in der Luft. Möwen am Himmel. Rauch aus der Räucherei. So fühlt sich ein Morgen an der Ostsee an. Doch an vielen Ständen heißt es immer öfter: „Dorsch gibt es heute nicht.“ Das ist kein Zufall. Es gibt Gründe – und die sind leider nicht schnell zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
Früher spielte der Dorsch die Hauptrolle
Über Jahrzehnte hinweg galt der Dorsch als sicherer Fang, Verkauf, Fischbrötchen – alles lief. Doch dann kippte die Entwicklung. Die Bestände brachen ein. Der gezielte Fang wurde stark begrenzt oder sogar komplett gestoppt. Seitdem ist Dorsch an der Küste selten geworden. Für viele Betriebe ist das sehr schwierig. Es betrifft Familien, Häfen und den Tourismus. Siehe auch: Online Marketing Hochseeangeln
Doch warum geht es dem Dorsch so schlecht?
Die Ostsee ist klein, flach und nur schwach mit dem Atlantik verbunden. In den tiefen Becken fehlt oft Sauerstoff. Gute Laichplätze werden rar. Zudem schwankt der Salzgehalt. Das erschwert die Aufzucht.
Hinzu kommt das Futter: Heringe und Sprütten sind nicht immer in den passenden Größen vorhanden. Zudem belasten Parasiten viele Tiere. Die Bestände wurden durch frühere Überfischung zusätzlich geschwächt. All diese kleinen Probleme zusammen ergeben ein großes.
Was bedeutet das für die Küste?
Fischerinnen und Fischer fahren weiter raus, aber mit anderer Beute. Sie fangen mehr Scholle und Flunder. Manche Kutter legen seltener ab. Räuchereien füllen ihre Auslagen mit dem, was verfügbar ist. Hering, Sprotte, Makrele (oft importiert) und Lachs aus Zucht. Dorsch gibt es, wenn überhaupt, nur noch als seltenen Beifang.
Und das Fischbrötchen?
Das beliebte „Kabeljau-Brötchen“ kommt heute oft nicht von der Ostsee. Häufig stammt der Fisch aus Nordsee oder Nordostatlantik. Backfisch im Fischbrötchen ist meist Alaska-Seelachs (Nordpazifik). Lachs ist in der Regel Zuchtlachs, oft aus Norwegen. Echt ostseetypisch bleiben Hering und Sprotte – je nach Saison und Quote. Der Geschmack bleibt top. Nur die Herkunft hat sich verschoben. Tipp: Nachfragen lohnt. Viele Stände geben die Herkunft offen an oder zeigen Siegel wie MSC/ASC.
Dorsch vs. Kabeljau – was ist der Unterschied?
Kurz & klar: Dorsch und Kabeljau sind dieselbe Art – der Atlantische Kabeljau (Gadus morhua). Unterschiede betreffen vor allem Wortgebrauch, Region, Saison und Verarbeitung, nicht die Biologie.
Begriffe, Praxis & Einkaufstipps im Überblick ( nach rechts schieben)
| Aspekt | Dorsch | Kabeljau | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Art (Biologie) | Beides Atlantischer Kabeljau – Gadus morhua | Kein biologischer Unterschied | |
| Namensgebrauch (Region) | Eher Ostsee & Küstenjargon | Nordsee/Atlantik & Handel | Regionale Sprachgewohnheit |
| Alter/Größe (umgangssprachlich) | Früher: kleiner/jünger | Früher: größer/älter | Tradition, heute nicht verbindlich |
| „Skrei“ | Wander-Kabeljau aus Nordnorwegen (Winter/Frühjahr) | Gleiche Art, besondere Saison/Qualität | |
| Verarbeitung | — | Stockfisch/Klippfisch = getrocknet/gesalzen | Nur die Verarbeitung unterscheidet |
| Geschmack & Textur | Weiß, fest, grobblättrig, mild | Unterschiede kommen von Fanggebiet, Größe, Frische, Behandlung | |
| Handelsangabe | Lateinischer Name Gadus morhua + FAO-Fanggebiet | Etikett verrät mehr als der Name | |
| Nachhaltigkeit | Auf Fanggebiet/Bestand & ggf. MSC-Siegel achten | Bestandslage schwankt je Gebiet/Jahr | |
| Im Fischbrötchen | Selten (Ostseedorsch knapp) | Oft aus Nordsee/Atlantik | Herkunft erfragen (Thekenschild/Personal) |
- Hinweis: Dorsch = Kabeljau. Der Unterschied liegt im Wort, nicht im Fisch.
- Merke: Für klare Herkunft immer auf den lateinischen Namen (Gadus morhua) und das Fanggebiet achten – das ist aussagekräftiger als „Dorsch“ oder „Kabeljau“.
Gibt es Hoffnung?
Ja, aber Geduld ist nötig. Entscheidend sind sauberes Wasser und stabile Lebensräume. Weniger Nährstoffe aus Landwirtschaft und Abwasser helfen. Schutz von Laichgebieten, Management nach wissenschaftlichem Rat und geringe Beifangmengen sind weitere Bausteine. Wenn alles zusammenspielt, kann sich ein Bestand erholen. Es dauert – aber es ist möglich.
Was Gäste jetzt tun können
- Nach dem Fanggebiet fragen
Formulierung für den Imbiss: „Ist das Ostsee-Dorsch oder Kabeljau aus dem Atlantik?“
An der Theke/auf dem Schild sollte stehen: Ostsee, Nordsee, Barentssee o. Ä. - Regional & saisonal wählen – mit Beispielen
Wenn Ostsee-Dorsch knapp ist: Hering, Sprotte, Flunder/Scholle aus der Region probieren.
Backfisch im Brötchen ist oft Alaska-Seelachs (nicht Ostsee) – das ist okay, aber nicht regional Ostsee. - Etikett lesen statt nur den Namen
Hilft immer: Lateinischer Name (Gadus morhua) + Fanggebiet. Das sagt mehr als „Dorsch“ oder „Kabeljau“. - Siegel als Orientierung nutzen
MSC/ASC zeigen Standards – sie ersetzen nicht die Herkunftsfrage, helfen aber bei der Einordnung. - Abwechslung macht’s
Heute kein Dorsch? Dann eben Matjes, geräucherte Sprotten oder Scholle – so bleibt Genuss regional und die Ostsee wird entlastet.
Was Betriebe brauchen
Die Betriebe/Boote, die früher gezielt Dorsch gefangen haben, gibt es so nicht mehr im Einsatz für Dorsch. Die gerichtete Dorschfischerei ist seit 2019/2022 geschlossen; heute ist nur noch stark begrenzter Beifang erlaubt. Viele Kutter haben umgestellt (z. B. auf Scholle/Flunder oder Sprotte/Hering) oder wurden stillgelegt/abgewrackt. Freizeit-Dorschangeln ist ebenfalls untersagt. Eine „Hochseefischerei auf Ostsee-Dorsch“ gibt es praktisch auch nicht mehr. Die wenigen Dorsche, die noch anlanden, stammen aus Beifang-Kontingenten, und auch die werden weiter gesenkt.
Was Betriebe jetzt brauchen
- Soforthilfe: Zuschüsse für Diesel, Liegeplatz, Versicherung – plus soziale Absicherung der Crews.
- Umrüstung: Selektive Netze/Haken, Technik für Plattfisch & Küstenfischerei; kurze, bezahlte Schulungen.
- Direktvermarktung: Hafenverkauf, Fischkiste, Online-Vorbestellung; mehr Wertschöpfung durch Räuchern/Einlegen.
- Tourismus & Partnerschaften: Kuttertouren, Verkostungen, feste Abnahme mit Gastronomie & Kantinen.
- Transparenz: Fanggebiet (FAO 22 „Ostsee“) auf dem Schild; QR-Code zur Route; regionale Labels/Siegel.
- Planungssicherheit: Mehrjahres-Regeln statt jährlichem Zittern; weniger Bürokratie, bessere Hafen-Infrastruktur.
- Ökologie & Zukunft: Ostsee entlasten, Beifang senken, Laichgebiete schützen, praxisnahe Forschung fördern.
Kurz: Jetzt zählen Liquidität, Umrüstung und klare Vermarktungswege – damit Küstenbetriebe die Zeit bis zur Erholung der Bestände überstehen.
Fazit: Der Dorsch ist nicht verschwunden, aber angeschlagen. Die Ostsee zeigt, wie empfindlich ein Meer sein kann. Gute Nachrichten entstehen leise: weniger Nährstoffe, bessere Schutzgebiete, klare Regeln. Bis der Dorsch zurück ist, tragen viele den Tisch weiter: Fischer mit anderen Arten, Küchen mit neuen Rezepten, Gäste mit neugierigen Fragen.
Kleines Ostsee-Glossar
- Beifang: Fisch, der beim Fang anderer Arten ungewollt mit ins Netz geht.
- Laichgebiet: Ort, an dem Fische Eier ablegen und Jungfische heranwachsen.
- Eutrophierung: Zu viele Nährstoffe im Wasser; das fördert Algen und schmälert Sauerstoff.
Hier ist ein unkompliziertes, richtig leckeres Ostsee-Flunder-Rezept – knusprig aus der Pfanne mit Zitronen-Butter. Plus zwei kurze Variationen.
Tipp: Flunder Rezept
Flunder „Meunière“ aus der Pfanne (für 2 Personen)
Zutaten
- 2 ganze Flundern (je 350–450 g, ausgenommen, geschuppt)
- Salz und Pfeffer
- 3 EL Mehl (alternativ Reismehl; optional nur leicht bemehlen)
- 2–3 EL Butterschmalz oder neutrales Öl
- 60 g Butter
- 1 Bio-Zitrone (Abrieb und Saft)
- 1–2 EL Kapern (optional)
- ½ Bund Dill oder Petersilie, grob gehackt
Beilagen-Ideen: Petersilienkartoffeln, Gurkensalat oder lauwarmer Kartoffelsalat.
Zubereitung
- Vorbereiten: Flundern kalt abspülen, gut trocken tupfen. Dunkle Oberseite mit einem scharfen Messer kreuzweise flach einschneiden (gegen das Wölben). Salzen und pfeffern, dünn mehlieren, Überschuss abklopfen.
- Braten: Butterschmalz in einer großen Pfanne auf mittelhohe Hitze bringen. Flunder mit der dunklen Seite zuerst 3–4 Min. braten, vorsichtig wenden und weitere 3–4 Min. braten (Garzeit je nach Dicke).
- Zitronen-Butter: Hitze etwas reduzieren, Butter zugeben und nussig werden lassen. Zitronenabrieb, 1–2 EL Zitronensaft und ggf. Kapern einrühren. Mit der Butter die Flunder überlöffeln.
- Servieren & entgräten: Auf Teller geben, Kräuter darüber. Zum Essen am Rücken entlang einschneiden, die Filets von der Mittelgräte abheben; Gräte herausnehmen und die Unterseite genießen.
Tipps
- Garpunkt: Innen saftig, leicht glasig (ca. 55–58 °C Kerntemperatur). Nicht übergaren – Flunder ist mager.
- Ohne Mehl: Nur leicht ölen und braten; für Extra-Knusper dünn mit Kartoffel- oder Reismehl bestäuben.
Zwei schnelle Variationen
1) Finkenwerder Art (herzhaft)
- 80 g gewürfelten Speck auslassen, 1 kleine Zwiebel fein würfeln und glasig mitbraten. Über die gebratene Flunder geben, mit Petersilie und Zitronensaft abrunden.
2) Aus dem Ofen (bequem)
- Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Blech ölen, Flunder salzen, pfeffern, mit Butterflocken, Zitronenscheiben und Dill belegen. 12–15 Min. garen. Dazu vorgekochte Drillinge auf dem Blech mitbacken.
Einkauf & Regional-Hinweis
- Frischemerkmale: Klare Augen, frischer Meeresduft, festes Fleisch.
- Regionalität: Nach Fanggebiet Ostsee fragen (FAO 22). Alternativ gelingt das Rezept auch sehr gut mit Scholle.
Beilagen-Ideen: Petersilienkartoffeln, Gurkensalat oder lauwarmer Kartoffelsalat.
Zubereitung
- Vorbereiten: Flundern kalt abspülen, gut trocken tupfen. Dunkle Oberseite mit einem scharfen Messer kreuzweise flach einschneiden (gegen das Wölben). Salzen und pfeffern, dünn mehlieren, Überschuss abklopfen.
- Braten: Butterschmalz in einer großen Pfanne auf mittelhohe Hitze bringen. Flunder mit der dunklen Seite zuerst 3-4 Min. braten, vorsichtig wenden und weitere 3-4 Min. braten (Garzeit je nach Dicke).
- Zitronen-Butter: Hitze etwas reduzieren, Butter zugeben und nussig werden lassen. Zitronenabrieb, 1-2 EL Zitronensaft und ggf. Kapern einrühren. Mit der Butter die Flunder überlöffeln.
- Servieren & entgräten: Auf Teller geben, Kräuter darüber. Am Rücken entlang einschneiden, die Filets von der Mittelgräte abheben; Gräte herausnehmen und die Unterseite genießen.
Tipps
- Garpunkt: Innen saftig, leicht glasig (ca. 55–58 °C Kerntemperatur). Nicht übergaren.
- Ohne Mehl: Nur leicht ölen und braten; für Extra-Knusper dünn mit Kartoffel- oder Reismehl bestäuben.
Zwei schnelle Variationen
1) Finkenwerder Art (herzhaft)
- 80 g gewürfelten Speck auslassen, 1 kleine Zwiebel fein würfeln und glasig mitbraten. Über die gebratene Flunder geben, mit Petersilie und Zitronensaft abrunden.
2) Aus dem Ofen (bequem)
- Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Blech ölen, Flunder salzen, pfeffern, mit Butterflocken, Zitronenscheiben und Dill belegen. 12-15 Min. garen. Drillinge vorgekocht mitbacken.
Einkauf & Regional-Hinweis
- Frischemerkmale: Klare Augen, frischer Meeresduft, festes Fleisch.
- Regionalität: Fanggebiet Ostsee (FAO 22) erfragen; alternativ Scholle verwenden.