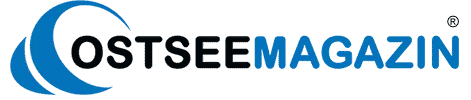Der „Tag der Danziger” erinnert jährlich an die wechselvolle Geschichte der einstigen Freien Stadt Danzig, die heute als Gdańsk zu Polen gehört. Dieses Gedenken ist insbesondere mit der Geschichte der deutschen Bevölkerung verbunden, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Stadt lebte und nach 1945 größtenteils vertrieben wurde.
Inhaltsverzeichnis
Historischer Hintergrund der Freien Stadt Danzig
Die Freie Stadt Danzig wurde 1920 nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, als sie gemäß dem Versailler Vertrag vom Deutschen Reich getrennt wurde. Unter dem Schutz des Völkerbundes genoss Danzig weitgehende politische Autonomie. Die Bevölkerung der Stadt war damals mehrheitlich deutsch, es gab jedoch auch eine polnische Minderheit. Während der Zwischenkriegszeit nahmen die politischen Spannungen zu, insbesondere nachdem die NSDAP im Jahr 1933 die Mehrheit erlangt hatte und einen Anschluss an das Deutsche Reich forderte.

Im Jahr 1939 kam es schließlich zur Annexion durch das nationalsozialistische Deutschland. Der Angriff auf die Westerplatte bei Danzig am 1. September 1939 gilt bis heute als der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Kriegsjahre brachten schwerste Zerstörungen und immense menschliche Verluste mit sich. Mit dem Vormarsch der Roten Armee im März 1945 endete die deutsche Geschichte Danzigs gewaltsam: Die Stadt wurde erobert, große Teile wurden zerstört und die deutsche Bevölkerung wurde nahezu vollständig vertrieben.
Entstehung und Bedeutung des „Tag der Danziger“
Nach dem Krieg fanden viele vertriebene Danziger in Deutschland ein neues Zuhause, doch die Sehnsucht nach ihrer Heimat blieb bestehen. Bereits 1946 gründeten sie den „Bund der Danziger e. V.“, der bis heute ihre Interessen vertritt und die Erinnerung an die alte Heimat bewahrt. Um diese Erinnerung lebendig zu halten, wurde 1950 erstmals der „Tag der Danziger” als zentrales Treffen der Vertriebenen aus Danzig organisiert.
In den ersten Jahrzehnten dienten die Treffen vor allem der Bewahrung kultureller Traditionen, der Erinnerung an die verlorene Heimat und der politischen Forderung nach Anerkennung der Vertreibungsschicksale. Städte wie Lübeck, Düsseldorf oder Hamburg übernahmen Patenschaften für die Vertriebenen und unterstützten diese Gedenkkultur aktiv.
In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Veranstaltung zunehmend in Richtung Versöhnung und Austausch mit dem heutigen Gdańsk und seiner polnischen Bevölkerung. Ein Meilenstein war der erste „Tag der Danziger” im Jahr 2015 in der Stadt Gdańsk selbst, genau 70 Jahre nach Kriegsende. Dieser Tag war geprägt von einer neuen Atmosphäre der Verständigung und des gegenseitigen Respekts zwischen den ehemaligen deutschen Bewohnern und den heutigen Bürgern der Stadt.
Der Tag der Danziger 2025 – Begegnung und Versöhnung in Gdańsk
Vom 10. bis 12. Oktober 2025 wird der „Tag der Danziger” erneut in Danzig gefeiert. Das Treffen steht dabei im Zeichen zweier bedeutender Jubiläen: zehn Jahre nach dem ersten offiziellen Treffen zwischen dem Bund der Danziger und der Stadtverwaltung von Gdańsk sowie 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Bund der Danziger plant dieses Treffen als Begegnung, die kulturellen Austausch, historisches Erinnern und deutsch-polnische Versöhnung fördert.
Für die Veranstaltung sind zwei historische Orte vorgesehen, die eine würdige und stimmungsvolle Umgebung für dieses wichtige Ereignis bieten: das Altstädtische Rathaus am Radaunekanal oder das Oblatenzentrum für Bildung und Kultur (das ehemalige Karmeliterkloster), eine wichtige Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer der Kriegsverbrechen von 1945.

Programm-Highlights des Tag der Danziger 2025
Das Programm für Oktober 2025 bietet vielfältige Möglichkeiten der Begegnung und des Austauschs. Ein besonderer Höhepunkt wird die Lesung des bekannten Danziger Schriftstellers Stefan Chwin sein. Er wurde durch seine Werke, wie „Tod in Danzig“, als Brückenbauer zwischen Deutschland und Polen bekannt. Magdalena Oxfort, Kulturreferentin für Westpreußen, wird diese Lesung simultan ins Deutsche übersetzen.
Darüber hinaus ist ein Vortrag von Daniela Grenz von der Polnisch-Deutschen Gesellschaft Danzig geplant. Sie unterstützt die Veranstaltung auch organisatorisch. Besonders bedeutsam wird die Begegnung mit Vertretern der deutschen Minderheiten sein. Sie sind in freundschaftlicher Atmosphäre zum Kennenlernen und Austausch eingeladen.
Neben kulturellen Programmpunkten sind thematische Stadtführungen geplant, etwa durch die historische Altstadt oder das berühmte Werftviertel. Der Kenner der Region Wolfgang Naujocks bietet zudem eine besondere Busfahrt durch das landschaftlich reizvolle Große Werder an. Dabei werden kulturelle und landschaftliche Höhepunkte der Region präsentiert.
Auch ernste Themen finden ihren Platz: Optional steht eine Führung durch das ehemalige Konzentrationslager Stutthof auf dem Programm, gefolgt von einem Ausflug an die Ostsee, um das Erlebte besser reflektieren zu können.

Praktische Informationen zur Teilnahme
Für Teilnehmer am Tag der Danziger 2025 wurde bereits ein Zimmerkontingent im „Novotel Gdańsk Centrum“ auf der Speicherinsel reserviert. Das Treffen findet vom 9. bis 13. Oktober 2025 statt. Interessierte können sich direkt beim Bund der Danziger per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch (0451-77303) anmelden.
Der Tag der Danziger heute – Ein Zeichen für Versöhnung und Zukunft
Der „Tag der Danziger” ist heute wichtiger denn je: Einerseits erinnert er an historische Ereignisse und deren Folgen, andererseits ist er ein lebendiges Zeichen für Verständigung und Versöhnung. Was einst aus der Trauer über den Verlust der Heimat entstand, hat sich zu einer Veranstaltung entwickelt, die Vergangenheit und Zukunft verbindet, Brücken baut und Menschen zusammenführt.
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Erinnerungen nicht nur als Mahnung wachzuhalten, sondern auch als Basis für gegenseitigen Respekt und Verständigung zu nutzen. Der „Tag der Danziger 2025” in Gdańsk setzt genau dieses Zeichen und lädt herzlich zur Teilnahme und Mitwirkung ein.